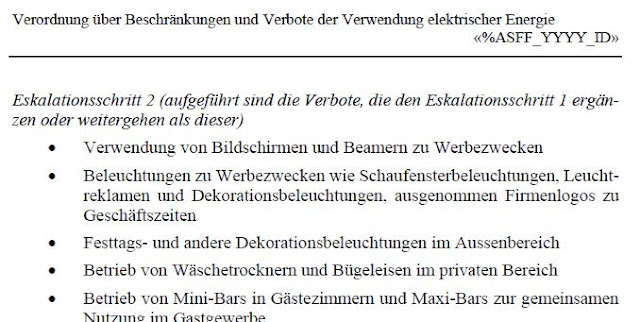Bekanntlich hat in unserem Dorfe an einem Heiligabend erstmals elektrisches Licht aus dem Stromnetz das Dunkel der Nacht erhellt. Also heute. Vor 110 Jahren, wie Willi Baumgartner-Thut (*1930) in seinem chronologischen Rückblick auf das 20. Jahrhundert (MGW, Januar 2000, S. 11-15) zum Jahr 1912 notiert hat:
«27. Mai: Gründung der Elektrizitäts-Genossenschaft Weiach (EGW), Netzausbau im 2. Halbjahr und erstmals Stromeinschaltung bei 85 Abonnenten und der Strassenbeleuchtung am 24. Dezember.» (zit. n. Brandenberger/Zollinger: Weiach. Aus der Geschichte eines Unterländer Dorfes, 6. Aufl. Vers. 55; Dezember 2022 – S. 92)
Erleuchtung hat pünktlich geklappt
Wie dieser denkwürdige Tag der ersten Einschaltung des Stroms aus technischer Sicht ablief, zeigt ein Protokollauszug, den wir ebenfalls Willi verdanken (vgl. Seite Geschichte auf der Website der EGW).
«Nachdem die Herren Ingenieurs Maag der Maschinenfabrik Oerlikon und Joos von der EKZ die Apparate im Transformatorenhaus [Luppenstrasse 1a] und die Leitungsanlage mittels eigens mitgebrachten Apparaten geprüft und einige kleine Unstimmigkeiten behoben, setzte Herr Joos um 16.30 Uhr die Anlage unter Strom.
Zur allgemeinen Freude und zur grossen Genugtuung der anwesenden Ingenieurs sowie des Personals der beteiligten Installationsfirmen und nicht zuletzt der Betriebskommission funktionierte die Anlage tadellos und ohne die geringste Unterbrechung konnte dieselbe unter Strom belassen werden, sodass die beiden Ingenieurs, nachdem sie dem anwesenden Personal der EGW nochmals die nötigsten Instruktionen wiederholt hatten, der Betriebskommission die Anlage übergeben.
Nach einigen kurzen Stunden, die die beiden Herren im Beisein der Betriebskommission und 2 Mitglieder des Vorstandes im" Sternen" zubrachten, reisten sie mit dem 8 Uhr Zug von Weiach ab.
Dank dem grossen Einsatz von Chefmonteur Stirnimann konnten die verspätet gelieferten Ausleger für die Strassenbeleuchtung noch rechtzeitig montiert werden und so das Dorf während den Feiertagen erstmals beleuchten. Die Ausleger wurden von Herrn Albert Meierhofer, Direktor der Broncewarenfabrik Turgi (ein Weiacher) der EGW geschenkt.»
Dieser Albert Meierhofer war übrigens der Vater der bekannten Kinderärztin Marie Meierhofer, Gründerin des heute nach ihr benannten Instituts für Psychohygiene im Kindesalter (vgl. Weiacher Geschichte(n) Nr. 115).
Die Gemeinnützige Gesellschaft als Transmissionsriemen
Die Elektrifizierung der Landschaft im Zürcher Unterland ist allerdings schon viele Jahre zuvor angestossen worden. Eine wichtige Rolle spielte die Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes Dielsdorf (GGBD). Sie besteht seit 1836, wurde damals noch unter dem Namen Regensberg gegründet und war massgeblich an der Gründung der Bezirkssparkasse und des Bezirksspitals beteiligt. Ende des Jahrhunderts dann auch bei der Entwicklung der damals aufkommenden Netzwerktechnologien in den Bereichen Schienenverkehr und Elektrizität.
In diesem letzteren Feld dürfte die treibende Kraft im Hintergrund die 1891 gegründete Brown, Boveri & Cie (Teil der heutigen ABB) aus Baden gewesen sein. Dieses Unrternehmen hatte die Produkte zur Stromerzeugung entwickelt hatten und wollte ihre breite Anwendung im Markt vorantreiben. Zwecks Ankurbelung ihres Geschäfts gründete die BBC 1895 eine Finanzierungsgesellschaft namens Motor AG (die spätere Motor-Columbus).
Wer nun letzlich auf wen zugegangen ist, ist schwierig zu eruieren. Sachdienliche Hinweise könnten aber allenfalls noch im Firmenarchiv der Atel Holding AG (so heisst die Rechtsnachfolgerin der Motor-Columbus) oder den alten Protokollen der GGBD zu finden sein.
Die Elektrizitätskommission nimmt die Arbeit auf
Erwiesen ist allerdings, dass die Gemeinnützige unseres Bezirks kräftig die Werbetrommel für die BBC gerührt hat. Und zwar durch die Gründung einer fünfköpfigen Elektrizitätskommission. Zu deren Aufgaben findet man detailliertere Angaben in der NZZ von Heiligabend des Jahres 1900:
«Zürich. (Korr.) In Sachen der Beschaffung elektrischer Kraft zu Beleuchtungs- und Betriebszwecken für die Gemeinden des Bezirkes Dielsdorf ist vor kurzem durch die Gemeinnützige Gesellschaft dieses Bezirkes ein Fünferkomitee bestellt worden, welches den Auftrag erhielt, die weiteren Vorarbeiten zu besorgen. Dieses Komitee hat nun an alle Gemeindevorstände des Bezirkes ein Cirkular erlassen, in welchem auf die Wichtigkeit der elektrischen Kraft als Triebkraft und die Bedeutung derselben für die wirtschaftliche Entwicklung einer Gegend aufmerksam gemacht und die Gemeindevorstände gebeten werden, für die Sache zu wirken, sei es durch Veranstaltung von Vorträgen, durch Belehrung der Gemeindegenossen, oder durch direkten Verkehr mit der Gesellschaft „Motor“ in Baden.»[s. dazu oben]
Die Elektrizitätskommission hat für ihre Mitglieder eine Arbeitsteilung eingeführt in der Weise, daß jedem derselben ein besonderer Wirkungskreis zugeteilt wurde, damit die Interessenten jeder Gegend wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie Ratschlag und Aufschluß nötig haben. So wurden Hrn. Kantonsrat Hauser die Gemeinden Stadel, Weiach, Bachs, Windlach, Neerach zugeteilt [wohl auch die Gemeinde Raat-Schüpfheim; sie war wie Windlach noch bis 1907 selbstständig]; in den Wehnthalgemeinden besorgt Hr. Gemeindeammann Widmer das Nötige, Hr. Guyer-Meyer wirkt in seiner Gemeinde Rümlang und in den umliegenden Gemeinden Affoltern [damals noch zum Bezirk Dielsdorf gehörend; seit 1934 in Zürich eingemeindet] und Oberglatt; Hrn. Sekundarlehrer Strickler in Andelfingen wurden nebst seiner Wohngemeinde noch die Gemeinden Dänikon-Hüttikon, Boppelsen, Buchs, Dällikon und Regensdorf-Watt übertragen. In Dielsdorf und Regensberg, Niederhasli, Oberhasli und Niederglatt giebt Hr. Pfarrer Schüepp in Dielsdorf den Interessenten die gewünschten Auskünfte.»
Bestens vernetzter Stadler
Der genannte Kantonsrat, Heinrich Hauser (1851-1905), war ein Stadler. Wohl einer der bestvernetzten Köpfe, die das Dorf in den letzten zweihundert Jahren vorzuweisen hat. Schon sein Vater war Gemeindepräsident. Er selber übernahm 1870 zusammen mit seinem Bruder den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb, wurde 1876 Gemeinderatsschreiber und Stadler Posthalter, zusätzlich war er Besitzer der Bäckerei und Wirtschaft Zur Post. Daneben betätigte er sich als Händler mit Getreide, Mehl und Holz. 1881 wurde er in den Kantonsrat gewählt, 1882 übernahm er die Funktion des Gemeindeammanns (im Kanton Zürich die Bezeichnung des Betreibungsbeamten), 1883-1892 und ab 1896 war er überdies auch noch Gemeindepräsident! Nicht zu vergessen sein Amt als Bezirksschulpfleger ab 1884. Und 1899 der Einsitz im Bankrat der Zürcher Kantonalbank. Kurz: Eine Machtfülle, die ihresgleichen sucht. Es gibt sogar einen Artikel im Historischen Lexikon der Schweiz über ihn, der sein Engagement u.a. so charakterisiert: «H. suchte den Anschluss von Gem. und Bez. an den techn. Fortschritt (Bahn, Elektrizität, Telefon).»
Touristenbahn nach Regensberg, Elektrotherapie-Anstalten, Aluminiumproduktion
Solche bestens vernetzten, mit Geschäftssinn begabte Personen waren aber durchaus nützlich, wie man den weiteren Ausführungen in der NZZ entnehmen kann. Denn da ging es um eine Infrastruktur- und Wirtschaftsentwicklung, bei der man Grosses im Sinn hatte:
«Im fernern hat die Elektrizitätskommission ein Arbeitsprogramm für ihr weiteres Vorgehen entworfen. Nach demselben soll auf die Verbesserung der schon bestehenden Verkehrsmittel und Fahrgelegenheiten Bedacht genommen werden, auch die Bestrebungen des schon bestehenden Eisenbahnkomitees Niederglatt-Stadel sind zu unterstützen, ebenso der Ausbau der Wehnthalbahn nach Döttingen anzustreben. Als weitere schon besprochene Projekte werden genannt eine elektrische Bahn Bülach-Dielsdorf und eine Touristenbahn Dielsdorf-Regensberg. Dazu kommt noch die schon mehrere Jahre alte Idee einer elektrischen Straßenbahn Regensdorf-Affoltern-Milchbuck. Selbstverständlich ist man sich wohl bewußt, daß bei allem dem mit den bestehenden Verhältnissen gerechnet werden muß.
Als neue Industriezweige, auf deren Einführung getrachtet werden soll, werden genannt die Gewinnung von Calciumcarbid aus dem vorhandenen Kalkgestein, und von Aluminium aus den vorhandenen Lehmlagern, auch ist von Einführung der Elektrotherapie, verbunden mit Wasserbehandlung, wofür Anstalten errichtet werden sollten, die Rede. Nebenbei wird der Hebung des Handwerks und der schon bestehenden Industrien alle Aufmerksamkeit gewidmet, und es ist eine Industrie-, Gewerbe- und Handwerksstatistik in Aussicht genommen. Als Agitationsmittel stehen zur Verfügung die beiden Bezirksblätter [gemeint sein dürften: die Bülach-Dielsdorfer Wochen-Zeitung (Zürcher Unterländer) und der Bülach-Dielsdorfer Volksfreund (Neues Bülacher Tagblatt)], ferner sind Vorträge in öffentlichen Versammlungen und Besprechungen in landwirtschaftlichen und gewerblichen Vereinigungen geplant.
Wie s. Z. [seiner Zeit] gemeldet, wird der Bezug elektrischer Energie aus dem in Erstellung begriffenen Elektrizitätswerk in der Beznau [1902 vollendet] beabsichtigt. Zur Zeit ist man damit beschäftigt, eine Uebersicht über die in Aussicht stehenden Kraftlieferungsverträge zu beschaffen. Im Bezirk Dielsdorf sollen bis jetzt für rund 1000 HP. Abnehmer gesichert sein [HP = Horse Power; es ging v.a. um elektrische Energie für den Betrieb mechanischer Anlagen]. Dazu kämen dann noch weitere Abnehmer in den Glatthalgemeinden; so in Oerlikon, Seebach, Rümlang, Kloten, Dietlikon, Bassersdorf, Wallisellen, Schwamendingen, Dübendorf. Versammlungen zur Besprechung dieser Angelegenheit haben letzthin stattgefunden in Regensdorf, Wallisellen und Kloten; weitere Versammlungen sind von verschiedenen Gemeindevorständen in Aussicht genommen.»
Man staunt, welche unglaubliche Fülle an Aktivitäten diese Kommission entfaltet hat. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass insbesondere Kantonsrat Hauser ein sehr beschäftigter Mann war, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass im Hintergrund die Geschäftsinteressen der Motor AG und deren Ingenieure am Werk gewesen sein müssen. Anders ist so ein Arbeitsprogramm kaum zu stemmen.
Abklärungen in Weiach verlaufen erstmal im Sand
Dass Hauser mit seinem Gemeindepräsidenten-Amtskollegen Jakob Nauer in Weiach (vgl. WeiachBlog Nr. 1853) schon aus rein geschäftlichen Gründen im Kontakt war, darf angenommen werden. In unserem Dorf musste der Vielbeschäftigte aber kaum tätig werden, er hätte offene Türen eingerannt, denn da gab es kraft Gemeindeversammlungsbeschluss bereits seit Ende Juli 1900 eine «Kommission für Vorstudien zur Erwerbung elektrischer Kraft» (vgl. WeiachBlog Nr. 1436), deren Arbeit Willi Baumgartner-Thut wie folgt würdigt:
«Der erste Anlauf für die Einführung der Elektrizität in Weiach in den Jahren 1900 bis 1902 mit mehreren Kommissionssitzungen, Wassermessungen in den Dorfbächen, Werkbesichtigungen und Verhandlungen mit den damaligen Elektrofirmen Joh. Jakob Rieter & Cie, Winterthur sowie Motor Aktiengesellschaft für angewandte Elektrizität, Baden ergaben keine Lösung.
Neun Jahre später am 13. Februar 1911 wählte die Gemeindeversammlung wieder eine Kommission zur Abklärung des Bedarfs an elektrischer Kraft in Weiach. Die Gemeindeversammlung am 26. März beauftragte die Kommission mit der EKZ Verbindung aufzunehmen und dann die elektrische Kraft möglichst rasch in Weiach zu installieren.» (Quelle: https://www.ewweiach.ch/geschichte)
Und mit Hilfe der 1908 gegründeten Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) ging es dann tatsächlich erstaunlich rasch. Bereits 639 Tage nach dieser Gemeindeversammlung erstrahlten die Lichter.
Quellen