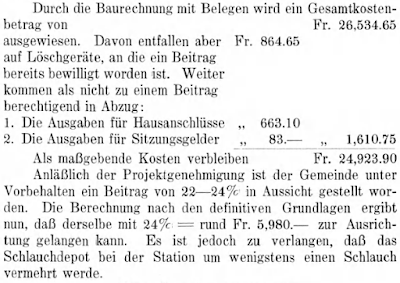Weyacher Eierschalen spielten im letzten Zürcher Hexenprozess vor 323 Jahren (dem sogenannten Wasterkinger Fall) eine Statistenrolle. Ein Beitrag zum Ostersonntag.
Von nützlichen und schädlichen vergrabenen Eiern
Eier hatten schon immer etwas Magisches an sich. Schlüpft doch daraus – nach simplem Bebrüten – neues Leben. Kein Wunder also sind Eier auch Teil des Hexenglaubens.
Der Winterthur Historiker und Kantonsschullehrer Patrick Hersperger schildert es so:
«Schon in vorchristlichen Kulturen wurden Eier eingefärbt. Das Ei ist ein uraltes mythologisches Symbol für die Entstehung der Welt, sowie allgemein für das Leben. Im Christentum steht es für die Auferstehung. Für die Menschen im Mittelalter war es zuerst ganz profan ein wichtiges Lebensmittel, das sie an Ostern, wenn die Fastenzeit zu Ende war, wieder essen durften. Sie brachten besonders die am Gründonnerstag gelegten Eier in die Messe und liessen sie vom Priester segnen. Diese lithurgische [sic!] Eierweihe, die im 12. Jahrhundert aufkam, hat verschiedene Volksbräuche wohl erst entstehen lassen. Die geweihten Eier wurden nämlich nicht alle verzehrt. [...] Da diesen Eiern eine besondere Kraft zugeschrieben wurde, hat man sie auch in Äckern vergraben, damit die Saat besser gedeihe. Das Ei wurde zudem als Unheil abwehrendes Mittel oder als Aphrodisiakum eingesetzt. Überliefert ist aus dem 16. Jahrhundert aber auch die Vorstellung, dass «Hexen» Schaden anrichten können, wenn sie ein Ei unter die Schwelle eines Hauses legen oder im Feld vergraben.» (Tagblatt der Stadt Zürich, 31. März 2010)
Wer im Hexenhammer blättert, dem ab 1486 in vielen Auflagen gedruckten Propagandawerk des Dominikaners Heinrich Kramer, der findet diese Eier-Bezüge im Zusammenhang mit Zauberei und Dämonen selbstverständlich auch dort.
Das in Latein verfasste und somit primär an Intellektuelle und Priester gerichtete Werk wurde erst später ins Deutsche übertragen. Gut lesbar wurde es u.a. 1906 von J. W. R. Schmidt übersetzt und mit einem Kommentar versehen (PDF, 30.5 MB, 642 S.).
Eier ins Grab getan, verursachen Epilepsie
Kramer arbeitet intensiv mit Praxisbeispielen, nennt auch Orte und Namen mitten im deutschsprachigen Raum, die nachprüfbare Authentizität signalisieren und letztlich doch anekdotische Evidenz bleiben. Illustrieren lässt sich das anhand des nachstehenden Absatzes (Schmidt 1906, S. II, 89):
«Als in derselben Diözese endlich, und zwar im Gebiete des Schwarzwaldes, eine Hexe durch den Henker zur Strafe für einen von ihr angestifteten Brand von dem Fußboden auf den Holzstoß gehoben wurde, sagte sie: "Ich werde dir eine Belohnung geben", wobei sie ihm in das Gesicht hauchte: Sofort war er am ganzen Körper mit schauerlichem Aussatz geschlagen und überlebte sie danach um nur wenige Tage. Ihre schauderhaften Schandtaten werden der Kürze wegen weggelassen; und so könnten darüber noch andere, schier unzählige, aufgezählt werden. Denn wir haben öfters gefunden, daß sie Epilepsie oder fallende Krankheit gewissen Leuten vermittels Eiern angetan haben, die mit den Körpern von Verstorbenen, in die Gräber getan worden waren, besonders mit solchen Beerdigten, die aus ihrer Sekte stammen, und die sie unter anderen Zeremonien, die nicht aufgezählt zu werden brauchen, jemandem im Tranke oder im Essen reichen.»
Mittels verhexter Eier in einen Esel verwandelt
Auf den Seiten II, 153-156 (wieder nach der Ausgabe 1906 v. Schmidt) wird ausführlich die Verhexung eines jungen Matrosen auf Landgang in einen Esel beschrieben. Sie soll durch eine zypriotische Zauberin aus Salamis (bei Famagusta, Türkische Republik Nordzypern) bewirkt worden sein, die ihm (wohl gekochte) Eier als Proviant mitgegeben habe. Nachdem er diese noch an Land gegessen habe, sei ihm wunderlich geworden. Seine eigenen Schiffskameraden hätten ihn danach – da in Eselsgestalt verwandelt und des Redens nicht mehr fähig – nicht erkannt und ihn (der natürlich unbedingt an Bord wollte) vom Schiff geprügelt. Deshalb sei ihm schliesslich nichts anderes übriggeblieben, als der Hexe drei Jahre als Lasttier zu dienen, bis seine Rettung durch genuesische Kaufleute erfolgen konnte. Diese hätten das Verhalten des Esels vor einer Kirche richtig gedeutet, sodass die Hexe habe verhaftet und der Fluch über den Matrosen aufgehoben werden können.
Transportvehikel zum Tanzplatz bei Berwangen
Vielleicht hat auch eine hiesige Hexe ein solches Ei gekocht und dann die Schale zweckentfremdet. So wurde bei den Wasterkinger Hexenprozessen im April 1701 die noch als Kind getätigte Aussage einer Beschuldigten protokolliert, eine Verwandte aus Weyach sei in einer Eierschale über Rhein nach Berwangen zum Tanz gefahren (Acta ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1990, S. 448).
Diese Ortschaft liegt im heutigen Baden-Württemberg, nördlich von Wil und Rafz, sowie südlich des Schaffhauser Klettgaus. Zu Fuss ist man von Weiach aus mindestens drei Stunden unterwegs bis dorthin. Heisst also, dass diese Weyacher Hexe eine Eierschale als fliegenden Teppich genutzt hat, denn nur um damit über den Fluss zu setzen wäre die magische Schale schon etwas zu schade, oder? Zumal, wenn in Berwangen ein Tanz auf einem – horribile dictu – Hexensabbat ansteht. Da braucht es standesgemässere Transportmittel.
Wir haben da also eine weitere der Zauberei verdächtige Weiacherin (vgl. u.a. Weiacher Geschichte(n) Nr. 99). Sie soll die Base der Beschuldigten sein, die diese Aussage an einer Liechtstubeten im Alter von 10 Jahren gemacht hatte. Wahrscheinlich ist damit (wie früher eher üblich) eine Tante gemeint (d.h. eine Schwester der eigenen Mutter bzw. des Vaters) und nicht eine Cousine. Mutmasslich handelt es sich bei dieser Base um Verena Rutschmann, verheiratet 1658 mit Jakob Rüdlinger in Weyach (StAZH E III 136.1, EDB 219).
Erstaunlich resiliente Gesellschaft
Wenn man solche, im Hexenhammer über viele Seiten ausgebreitete Beschreibungen von Horrorgeschichten liest, muss man sich fast wundern. Wundern darüber, dass nicht – wie seit den 1970ern v.a. in feministisch-woken Kreisen immer wieder fälschlicherweise kolportiert wird – ganze Dörfer auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Und daraus abgeleitete Zahlen, wonach Millionen Hexen allein in Europa verbrannt worden sein sollen, plausibel erscheinen. Denn da waren ja sehr viele Menschen potentiell nur schon durch Verwandtschaft oder sonstigen direkten Umgang mit einer Hexe schwer kontaminiert. Kontaktschuld in ihrer reinsten Form.
Dass es nicht so weit gekommen ist, verdankt die damalige Zeit auch besonneneren Amtsträgern, wie dem Bischof von Brixen, der nach einer Untersuchung besagten Dominikaner (und damit Inquisitionsspezialisten) Heinrich Kramer aus der Stadt Innsbruck und dem Land Tirol hinauswerfen liess, als er dort im grossen Stil seine Hexenverfolgungskampagne ausrollen wollte.
Auch in der Stadt Zürich waren die Dominikaner schon ihres Inquisitionseifers wegen ziemlich verhasst, was erklären könnte, weshalb aus den Reihen der Zürcher Bürger über all die Jahrhunderte nur eine einzige Frau als Hexe hingerichtet wurde. Alle anderen Opfer (rund 80) stammten aus den Untertanengebieten auf der Landschaft.
Quellen und Literatur
- Institoris, H.: Der Hexenhammer (Malleus maleficarum). Aus dem Lateinischen übertragen und eingeleitet von J. W. R. Schmidt, 1906. Teil I, Teil II, Teil III.
- Verwandtschaftsbeziehungen der Angeklagten des Wasterkinger Hexenprozesses von 1701. In: Neukom, Th; Stühlinger, P.; Voegeli, H.: Wasterkingen – ein Dorf und seine Grenzen. Chronos Verlag, Zürich 2002 – S. 71.
- Brandenberger, U.: «Mit güete ald der marter». Die Weyacher Hexenprozesse von 1539 und 1589. Weiacher Geschichte(n) Nr. 99. In: Mitteilungen für die Gemeinde Weiach, Februar 2008.
- Hersperger, P: Kirche, Magie und ›Aberglaube‹. »Superstitio« in der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts. Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, Bd. 31. Böhlau Verlag, Köln 2010.
- Strobel, J.: «Hexen konnten mit Eiern Schaden anrichten». Interview mit Patrick Hersperger. In: Tagblatt der Stadt Zürich, 31. März 2010 – S. 29.
- Brandenberger, U. (ed.): Die Weiacher Hexenprotokolle. Eine Zusammenstellung der verfügbaren Informationen. Wiachiana Doku Bd. 1 -- Fünfte, erw. u. korr. Aufl., Oktober 2023 (PDF, 3.76 MB).