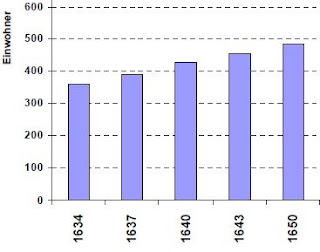«Januar: Eine sauber-weisse Landschaft begrüsst uns am Neujahrsmorgen. Ist's wohl ein gutes Omen für die Witterung des ganzen Monats? - Schon am zweiten Tag aber wirds leicht regnerisch und der Schnee weicht wieder. Dafür bringen im Laufe des Monats verschiedene andere Tage neuen z.T. sogar reichlichen Schneefall, nämlich der 5. 8. 11. 12. 19. 27. und 30. Januar. So ist der ganze Monat, wie er's am ersten Tag anzeigte, für unsere Kinder wieder einmal ein richtiger Bringer von Winterfreuden.
Das erste Monatsdrittel ist nicht übermässig kalt, immer so zwischen -2° und +2°C; aber gegen die Monatsmitte wird es kälter: -8°, -12°, am 14. morgens sogar -23°! Jetzt heisst's heizen und aufpassen, dass die Wasserleitungen nicht einfrieren. Die Kälte nimmt nach dem 15.1. nur wenig ab, die Morgen zeigen immer noch so um -10° bis-12°C, vom 20.1. an sogar wieder -16°, -18°, -19° und auch tagsüber hält sich die Kälte immer erheblich unter 0°, durchschnittlich bei -7°. Die Dorfbrunnen überziehen sich einer nach dem andern mit einer dicken Eiskruste und fangen an langsamer und langsamer zu fliessen, bis die meisten überhaupt zu "streiken" beginnen. Bei unserm "Mühlebrunnen" musste ich vom 20.1. an die Eiskruste jeden Morgen mit einem Beil einschlagen, damit es den Trog nicht etwa versprenge. Er stammt nämlich aus dem Jahre 1790 (siehe 1952-er Chronik) und da wär's doch schade um ihn.
Im übrigen gab es neben ziemlich vielen Tagen mit trübem, nebligem Wetter, oder doch mit kompakter Hochnebeldecke, auch einige recht sonnige Nachmittage oder Abende, dazu vier ganze sonnige Tage. Allerdings blieb es trotzdem auch an diesen recht kalt; der Oberwind beherrschte das Feld. Also, der Jänner hat seine Sache fachgerecht gemacht, er soll ja beileibe nicht warm sein, denn: "Januar warm --- dass Gott erbarm!»
Die Kälte führte übrigens zu einem der seltenen Fälle in denen grosse Seen im Schweizer Mittelland zufrieren - sie war die Voraussetzung für die Seegfrörni 1963 auf dem Zürichsee.
Quelle
- Zollinger, W.: Gemeinde Weiach. Chronik des Jahres 1963 - S. 3. [Original in der Handschriftenabteilung der Zentralbibliothek Zürich. Signatur: G-Ch Weiach 1963].