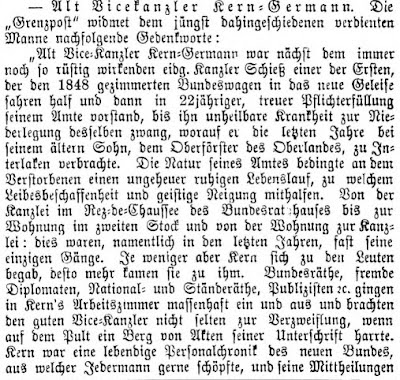Was hatten Sie unterm Tannenbaum? Bei mir war schon kurz nach dem Chlaustag Weihnachten. Nämlich, als ich ein dickes Paket mit dem gerade erst erschienenen Band «Der Bezirk Dielsdorf» aus der Reihe «Die Kunstdenkmäler der Schweiz» aus dem Postfach ziehen konnte.
Seither ist jeder Tag, an dem ich drin gelesen habe, ein bisschen wie Geschenke auspacken. Und wie das so ist mit Geschenken: Die Reaktionen können frei variieren zwischen «Wow!!!» und «Ojee...». Diese Rezension gibt eine kurze «tour de livre», die natürlich vor allem den Weiacher Abschnitt abdeckt.
Gut Ding will Weile haben
Können Sie sich noch an den Sommer 2018 erinnern? Da hat die Gemeinde die beiden einzigen Seiten über Weiach aus dem 1943 publizierten Kunstdenkmälerband auf ihrer Website zum Download bereitgestellt. Versehen mit der Bitte, den Experten der Uni Zürich, die mit einer Neubearbeitung betraut wurden, wo möglich behilflich zu sein.
Dieses Projekt der Kunstdenkmäler-Inventarisation war eines, das unsere Gegend nur alle paar Jahrzehnte erlebt. Wann interessieren sich heutige Historiker schon für die Gemeinde Weiach? Mit Regula Crottet, Anika Kerstan und Philipp Zwyssig waren in den letzten Jahren drei Fachleute am Werk, die nicht nur das Wissen haben, sondern auch die Zeit zur Verfügung gestellt erhielten, gründlich und tief genug in die Materie einzutauchen. So tief, dass sie den Dingen auch wirklich auf den Grund gehen konnten.
V.l.n.r.: Anika Kerstan, Regula Crottet, Philipp Zwyssig (Bild: zvg GSK)
Minutiöse Arbeit im Feld, in Archiven und Labors
Vor Ort und in den Archiven ist an vorderster Front und hinter den Kulissen Detektivarbeit geleistet worden, die uns in der Forschung weitergebracht haben. Das sieht man dem Inhalt des 560 Seiten starken Werk auch an. Zwei Beispiele seien herausgegriffen:
Philipp Zwyssig hat Verbindungen zwischen der Baugeschichte der Bachser Kirche (1713/14) und derjenigen von Weiach (1705/06) nachgewiesen, deren Spuren man nur findet, wenn man alte Ratsprotokolle ausfindig machen, sie entziffern und richtig einordnen kann. Die Gemeinsamkeit liegt in der Konzeption der Anlagen, die sowohl bei uns wie in unserer Nachbargemeinde die Handschrift des Festungsingenieurs Oberstleutnant Hans Caspar Werdmüller trägt.
Auf Veranlassung der Denkmalpflege des Kantons Zürich wurde die tragende Holzkonstruktion unseres Ortsmuseums durch das Laboratoire Romand de Dendrochronologie beprobt und analysiert. Resultat: Das Kleinbauernhaus am Müliweg 1 ist um Jahrzehnte älter als man bis dahin angenommen hat (vgl. Weiacher Geschichte(n) Nr. 63 auf dem Stand April 2019).
Gliederung des Bandes
Was findet man in diesem dicken Buch? Zunächst eine Einführung zu Geografie, Siedlungs- und Herrschaftsgeschichte über den gesamten Bezirk hinweg; sie stammt von Zwyssig. Die ausführliche Übersicht zur Architekturgeschichte des Bezirks hat die Kunsthistorikerin Crottet verfasst.
Danach folgen dem Alphabet nach die Gemeindeabschnitte: Der Geschichtswissenschaftler Zwyssig gibt für jede der 22 Gemeinden des Bezirks in einer Einleitung einen Abriss zu Lage, Geschichte und Siedlungsentwicklung. Die in den jeweiligen Dokumentationslisten genannten Literatur- und Archivbestände lassen nur erahnen, wie viel bisher unerschlossenes Material er gesichtet und transkribiert hat. Einen kleinen Einblick in diese Fülle vermittelt der Beitrag WeiachBlog Nr. 1395 vom 30. April 2019.
Weiacher Kirchenbezirk kommt gross heraus
Für den Weiacher Teil beschreibt die Kunsthistorikerin Kerstan eine Auswahl der heute noch vorhandenen Objekte in ihrem Ortszusammenhang. Beginnend mit bäuerlichen Mehrzweckbauten, bei denen in Weiach das dreigeteilte, sogenannte Mitterstallhaus vorherrscht (im Süden des Bezirks ist das Tenn in der Mitte, nicht der Stall), über Wohn- und Gewerbebauten, Bauten mit öffentlicher Funktion (mit besonderer Berücksichtigung der Schulbauten) werden Geschichte und Gestalt in den Kontext gestellt.
Besonderes Augenmerk gilt selbstverständlich dem sog. Kirchenbezirk. Nach Auffassung der Fachleute besteht er aus der Kirche, dem Pfarrhaus und der Pfarrscheune. Für die Weycher gehört natürlich auch das Alte Gemeindehaus dazu (das im Kunstdenkmälerband aber nur indirekt erwähnt wird, nämlich in seiner verschwundenen Form als Schulhaus von 1802 bis 1836). Die ausführliche Würdigung des Weiacher Baudenkmals par excellence erstreckt sich über mehr als fünf Seiten, was rund einem Drittel des unserer Gemeinde gewidmeten Raums entspricht.
Eingehender besprochen werden auch das Ortsmuseum, die ehemalige Mühle im Oberdorf sowie das dreigeteilte Bauernhaus Oberdorfstrasse 25/27/29 (Nr. 25 = sog. Fauquex-Haus mit bemalter Fassade).
Dreiunddreissig Gebäude erwähnt
Alles in allem sind es 33 Weiacher Bauwerke, die Erwähnung finden, darunter zwei der alten Waschhäuser (eins im Büel und eins im Oberdorf). Aber auch (für mich) eher unerwartete Bauwerke, wie das ehemalige Kleinbauernhaus der letzten Gemeindeweibelin Hildia Maag (Chälenstrasse 20). Dessen Innenausstattung lässt einen staunen und führt zur Erkenntnis, dass das Gebäude wesentlich älter sein dürfte, als die Angaben der kantonalen Gebäudeversicherung es bisher vermuten liessen.
 Ausschnitt aus der dem Abschnitt Weiach vorangestellten Übersichtskarte (Bild: KdS 146, S. 475)
Ausschnitt aus der dem Abschnitt Weiach vorangestellten Übersichtskarte (Bild: KdS 146, S. 475)
Nachstehend die vollständige Liste (in eckigen Klammern die auf dem Plan eingetragene Nummer):
- Alte Poststrasse 2, Vielzweckbauernhaus [17]
- Chälenstrasse 19/21a/21b, Vielzweckbauernhaus [27]
- Chälenstrasse 20, Bauernhaus [28]
- Büelstrasse 3, Vielzweckbauernhaus [10]
- Büelstrasse 6, Bauernhaus [11]
- Büelstrasse 13, ehem. Schul-, Gemeinde- und Spritzenhaus [6]
- Büelstrasse 15, ref. Kirche [1]
- Büelstrasse 19, ehem. Pfarrscheune, Kirchgemeindehaus [2]
- Büelstrasse 17, ref. Pfarrhaus [3]
- Büelstrasse 17.1, Waschhaus [4]
- Büelstrasse 17.2, Gartenpavillon [5]
- Büelstrasse 18, Wohnhaus, ehem. Fachwerkspeicher [8]
- Büelstrasse 18.1, Waschhaus [7]
- Luppenstrasse 1a, Trafostation [9]
- Müliweg 1, Vielzweckbauernhaus, Ortsmuseum [22]
- Müliweg 3, ehem. Vielzweckbauernhaus [23]
- Müliweg 4, Wohnhaus [26]
- Müliweg 7a/7b/7c, Wohn- und ehem. Mühlengebäude [25]
- Müliweg 7.1, ehem. Ökonomiegebäude [24]
- Oberdorfstrasse 2, Vielzweckbauernhaus [14]
- Oberdorfstrasse 9, Vielzweckbauernhaus [18]
- Oberdorfstrasse 9.1, Waschhaus [18]
- Oberdorfstrasse 13, Vielzweckbauernhaus [19]
- Oberdorfstrasse 20c.1, Waschhaus [20]
- Oberdorfstrasse 22, Vielzweckbauernhaus [20]
- Oberdorfstrasse 25/27/29, Vielzweckbauernhaus [21]
- Schulweg 2, Schulhaus [15]
- Stadlerstrasse 2, Wohn- und ehem. Wirtshaus Sternen [13]
- Stadlerstrasse 3, Wohn- und ehem. Gewerbebau [12]
- Stadlerstrasse 16, ehem. Vielzweckbauernhaus mit Restaurant Linde [16]
- Im See 2, Fabrikgebäude [29]
- Kaiserstuhlerstrasse 48, alter Bahnhof [30]
- Kaiserstuhlerstrasse 56, ehem. Sägerei, Holzgrosshandel [31]
Man sieht, dass auch die ehemalige Schäftenäherei Walder und spätere Sattlerei Fruet beim Alten Bahnhof sowie die Gebäude des Holzhändlers Heinrich Benz AG Aufnahme gefunden haben.
Moderne Mittel im Einsatz
Wer das Buch zur Hand nimmt, erhält noch viele weitere Einblicke. Einen interaktiven Vorgeschmack erhält man über:
- ein Kurzvideo auf Youtube, das die Publikation bewirbt und ein paar Seiten zeigt;
- die Website der Herausgeberin, der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), wo man sich auf einen mit 360°-Kamera aufgenommenen virtuellen Rundgang durch zwei Zimmer des ehemaligen Amts- und Zeughauses Regensberg begeben kann (vgl. nachstehenden Screenshot)
Mit eindrücklichen Bildern illustrierte Einblicke in die Arbeit der drei Autoren gibt ein Artikel aus dem Hause TAmedia, verfasst von Sharon Saameli, ursprünglich wohl im Zürcher Unterländer erschienen. Er beschreibt den Wow-Effekt, den Regula Crottet hatte, als sie den Dachstuhl des Stadler Bauernhauses Bergstrasse 2 zu Gesicht bekam. Nun ist für dieses seltene Exemplar eines vor 400 Jahren weitverbreiteten Bautyps in unserer Gegend dendrochronologisch belegt, dass das Konstruktionsholz schon 1617, kurz vor dem Dreissigjährigen Krieg, aus dem Wald geholt worden ist.
Betonburgen? Auch «Göhnerswil» ist bauliches Kulturerbe
Neben diesen altehrwürdigen Zeugen der Baukultur haben aber auch neueste Erscheinungen der Architektur den Weg zwischen die Buchdeckel gefunden, wie man auf einer Website des Kantons Zürich herausfindet, die folgende Kurzbeschreibung des Werks gibt:
«Der Bezirk Dielsdorf im Nordwesten des Kantons Zürich zeichnet sich durch eine grosse baukulturelle Vielfalt aus. Das bauliche Kulturerbe der einst stark vom Acker- und Weinbau geprägten Region umfasst neben dem Landvogteistädtchen Regensberg mit dem Burgturm, dem Schloss und seinen ins 16./17. Jh. zurückreichenden Bürgerhäusern auch Wohnblocksiedlungen der 1960/70er-Jahre wie etwa die «Sonnhalde» der Ernst Göhner AG, neben dem Katzenrütihof (1563) des europaweit bekannten «philosophischen Bauern» Kleinjogg Gujer (1718–1785) und zahlreichen weiteren Vielzweckbauernhäusern des 16.–19. Jh. auch von der Expo 64 beeinflusste Aussiedlungshöfe, neben Chorturmkirchen mit bis ins Spätmittelalter zurückgehender Bausubstanz auch moderne Gotteshäuser von bekannten Architekten wie Ernst Gisel oder Justus Dahinden. [...]»
Einfach, standardisiert und doch höchst auffällig
In den Medienunterlagen findet man übrigens nicht etwa ein Bild der Bachser oder der Niederhasler Kirche. Obwohl es sich vom Prinzip her bei allen dreien um schlichte Saalkirchen mit Chorabschluss aus den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts handelt und sich die Dachreiter von Niederhasli (1703) und Weiach (1706) fast zum Verwechseln gleichen: ausgewählt wurde dieses Bild, das unsere Kirche vor der letzten Renovation 2020 zeigt (erkennbar am abblätternden Putz an der Giebelseite):
 Weiach, Büelstrasse 15, ref. Kirche von 1705–06. Um den Kirchhof, der aufgrund seiner Lage an der Konfessionsgrenze als militärischer Stützpunkt mit wehrhaften Umfassungsmauern ausgestaltet wurde, gruppieren sich neben der Kirche das Pfarrhaus und die ehem. Pfarrscheune. Das Ensemble gilt schweizweit als seltenes Beispiel einer «Wehrkirche».
Weiach, Büelstrasse 15, ref. Kirche von 1705–06. Um den Kirchhof, der aufgrund seiner Lage an der Konfessionsgrenze als militärischer Stützpunkt mit wehrhaften Umfassungsmauern ausgestaltet wurde, gruppieren sich neben der Kirche das Pfarrhaus und die ehem. Pfarrscheune. Das Ensemble gilt schweizweit als seltenes Beispiel einer «Wehrkirche». (Bild: Urs Siegenthaler, Zürich, 2019.)
Wer etwas hat springen lassen. Und wer nicht.
Abschliessend sei hier noch eine Randnotiz angebracht. Die finanziell (noch) gut gepolsterte
Politische Gemeinde Weiach hat sich nicht zu einem Beitrag an die Erstellungskosten durchringen können. Die nicht ansatzweise so auf Rosen gebettete
Evang.-ref. Kirchgemeinde Weiach hingegen sehr wohl (wie man dem Impressum auf Seite 4 entnehmen kann):
Literaturhinweise und Materialien
- Hermann Fietz: Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich. Band II: Die Bezirke Bülach, Dielsdorf, Hinwil, Horgen und Meilen (= Die Kunstdenkmäler der Schweiz, Band 15). Bern 1943 – S. 143-144.
- Regula Crottet, Anika Kerstan, Philipp Zwyssig: Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Neue Ausgabe VII. Der Bezirk Dielsdorf (= Die Kunstdenkmäler der Schweiz, Band 146). Bern 2023 – S. 474-491. ISBN 978-3-03797-827-6; CHF 120; Bezug über shop.gsk.ch
- Medienmitteilung und Materialien zur Buchvernissage vom 13. November 2023 in Dielsdorf.