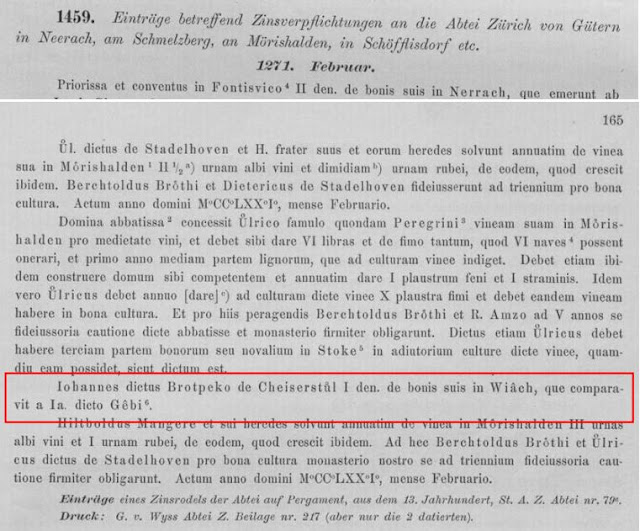Ein wichtiger Wegbereiter für die Gemeinde Weiach ist von uns gegangen. Mauro Lenisa 1948-2018. R.I.P. (Necrologia Wiachiana) pic.twitter.com/h2vLXry3zy— WeiachTweet (@WeiachBlog) 22. Dezember 2018
Der Redaktor des WeiachBlog spricht der Trauerfamilie auf diesem Weg sein Beileid aus.
Im Gedenken an unseren ehemaligen Gemeindepräsidenten wird an dieser Stelle ein von Mauro verfasster Artikel eingerückt. Er zeigt beispielhaft auf, welche Ziele er zusammen mit seinen Gemeinderatskollegen während seiner Amtszeit von 1982 bis 1990 verfolgt hat.
Heute würde man das Nachstehende wohl ein «Leitbild» nennen. Früher nannte man das noch ganz bescheiden «Ziele». Der Sinn und Zweck bleibt aber der gleiche. Möge das damals Gesäte auch in unseren Tagen Frucht tragen.
Weiach – eine Dorfgemeinschaft verwirklicht sich
Von Gemeindepräsident Mauro Lenisa
Im Lauf der jüngsten Geschichte hat die Gemeinde Weiach verschiedene Zeitabschnitte erlebt, welche die Behörden vor jeweils unterschiedlich gelagerte Aufgaben stellten. Die sechziger und der Beginn der siebziger Jahre waren durch den Ausbau der Infrastruktur geprägt. In der Folgezeit standen der Neubau des Schulhauses und die kommunale Richtplanung zuoberst auf der behördlichen Traktandenliste.
Dieser Zeitabschnitt wurde zu Beginn der Amtszeit der jetzigen Behörde abgeschlossen. Der Gemeinderat setzte sich für die laufende Amtsperiode zum Ziel,
- die Dorfbevölkerung offen über die Belange der Gemeindepolitik zu orientieren und damit zur aktiven Teilnahme zu motivieren;
- bestehende, starre Richtlinien zu hinterfragen und zu überdenken;
- die persönlichen Kontakte und den Gedankenaustausch zu intensivieren;
- ganz allgemein das Wohlbefinden der Dorfbevölkerung zu steigern.
Offenheit in Politik und Information
Um diesem Anliegen gerecht zu werden, benötigten die Behörden ein Werkzeug. Es wurde in Form des «Mitteilungsblattes für die Gemeinde Weiach» geschaffen. Im monatlichen Rhythmus wird aus der Arbeit der Behörden berichtet. Mit persönlichen Artikeln einzelner Behördemitglieder wird auch über die Hintergründe einzelner Entscheide informiert. Die Tatsache, dass sich Leser mit Stellungnahmen zu aktuellen Problemen äussern, zeigt, dass das Mitteilungsblatt beliebt und unentbehrlich geworden ist.
Anstrengungen im Natur- und Landschaftsschutz
Der Beschluss der Grundeigentümer, die Güterzusammenlegung durchzuführen, bedeutete für die Weiacher Landwirte einen Lichtblick, ermöglicht sie doch für die Betriebe eine Planung auf lange Zeit. Güterzusammenlegungen sind aber nicht nur mit eitel Freude verbunden. Vielerorts wurde bei ihrer Durchführung der Forderungen von Natur- und Landschaftsschutz wenig Beachtung geschenkt. Den Behörden ist es ein grosses Anliegen, gemeinsam mit der Meliorationsgenossenschaft und den Grundeigentümern zu zeigen, dass eine Erhöhung der Effizienz und Produktivität in der Landwirtschaft ohne Zerstörung unserer Umwelt erreicht werden kann.
Ziel: Wohlbefinden
Wohlbefinden in einem Dorf kann mit Zusammengehörigkeitsgefühl umschrieben werden. Hier werden Gefühle und Verhalten angesprochen - nicht Zahlen und Kurven. Zu erkennen, dass ein Gespräch oft der Frustration und Enttäuschung vorbeugen kann, ist Voraussetzung. Eine Güterzusammenlegung ohne gegenseitiges Vertrauen und ohne Gesprächswillen, z.B. zwischen Grundeigentümer und Pächter, ist kaum denkbar. Wir Weiacher scheinen dies verstanden zu haben.
Das hübsch renovierte «alte Schulhaus» brachte Platz für die Schul- und Gemeindebibliothek. Mit viel Elan versucht die neukonstituierte Bibliothekskommission, das Interesse für Kunst und Literatur zu wecken. Die übrigen Räume werden den Dorfvereinen zur Verfügung gestellt. Der warme Kachelofen lädt geradezu zu Kaffee und Kuchen ein!
In der neu erstellten Schulanlage bemühen sich zur Zeit 47 Schülerinnen und Schüler der Primarschule ums ABC. Die Schule wird in Doppelklassen geführt. Als Unikum ist zu erwähnen, dass die fünfte Klasse lediglich von einem Knaben und einem Mädchen besucht wird. Das besonders gute Verhältnis zwischen Eltern, Lehrerinnen, Schülern und Schulbehörde ermöglicht eine optimale Führung des Schulbetriebes. Die Sekundarschule, Realschul- und Oberschulstufe besuchen die Weiacher Schüler in Stadel. Leider führt der Radweg noch nicht bis ins Dorf, so dass die Schüler auf ihrem Schulweg die Hauptstrasse benützen müssen. Die Weiterführung des Radweges ist dringend notwendig.
Die Bautätigkeit hat zwar nicht abgenommen, sich aber doch eher auf Umbauten verlagert. Viele schön herausgeputzte Riegelbauten schmücken das Dorf, und die Neubauten fügen sich gut ins Dorfbild ein. Eine rege Tätigkeit hat sich in Form von Sanierungen in bezug auf das Wasser-, Abwasser- und Elektrizitätsnetz entwickelt. Die Müllbeseitigung ist in Weiach geregelt. Die Gesundheitsbehörde hat dieses Problem seit Jahren erkannt und hat auch Lösungen dazu gefunden.
Es liegt nun an jedem einzelnen, auch danach zu leben und zu handeln.
Quelle
Unpaginierte Beilage zu: Neues Bülacher Tagblatt, Mittwoch, 18. April 1984.